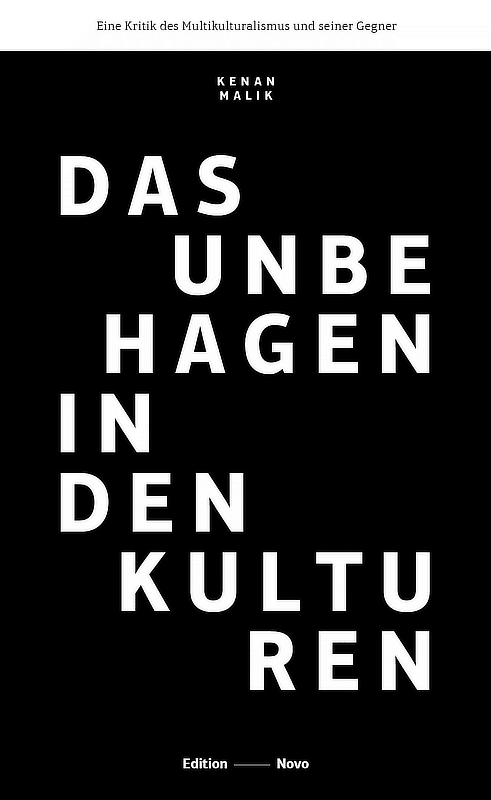08.06.2018
Die kulturalistische Wende
Von Kenan Malik
Weder der Multikulturalismus noch seine Gegner bieten gute Antworten auf den Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt, so die Einleitung des im Novo Argumente Verlag erschienenen Buchs „Das Unbehagen in den Kulturen“.
„Kann Europa bleiben, was es ist, wenn andere Menschen darin leben?“ Diese Frage stellte sich bereits vor einigen Jahren der amerikanische Autor Christopher Caldwell. Seit die Einwanderung, insbesondere die muslimische Einwanderung, immer mehr ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit rückt, beschäftigt diese Sorge auch immer mehr Europäer mit wachsender Dringlichkeit.
Im Kern geht es um das Problem, wie westliche Gesellschaften auf den Zustrom von Menschen reagieren sollen, die anderen Traditionen angehören, eine andere Herkunft haben und anderen Religionen folgen. Wo müssen in solchen Gesellschaften die Grenzen der Toleranz verlaufen? Sollen Immigranten gezwungen werden, sich an westliche Sitten und Normen anzupassen oder beruht Integration auf Gegenseitigkeit? Mit solchen Fragen plagen Politiker und Politikberater sich nun seit über einem halben Jahrhundert.
Der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt
Die Auseinandersetzungen um gesellschaftliche Vielfalt verschärften sich infolge zweier Probleme, die den gegenwärtigen politischen Diskurs in Europa inzwischen dominieren – erstens die Einwanderungskrise und zweitens der Terrorismus. Als Reaktion entwickelten viele Menschen Angst vor Vielfalt. Sie betrachteten Einwanderung als Quelle von Terroranschlägen und als Ursache sich immer weiter fragmentierender Gesellschaften. Dies wiederum führte zum Ruf nach dem Ende muslimischer Einwanderung und strengerer Überwachung islamischer Gemeinschaften.
Bis vor kurzem hielten viele Menschen Multikulturalismus für den am besten geeigneten Ansatz, Vielfalt zu verwalten. Multikulturalismus ist ein oftmals schwer zu definierender Begriff (insbesondere, weil das Konzept, wie ich im Buch zeigen werde, zwei Dinge miteinander vermischt, nämlich einerseits die Beschreibung einer Gesellschaft und andererseits ein Bündel politischer Maßnahmen, diese Gesellschaft zu verwalten). Den meisten multikulturalistischen Politikformen liegt jedoch die Vorstellung zugrunde, dass jede Gesellschaft aus einer „Gemeinschaft von Gemeinschaften“ besteht, und dass sich Politik größtenteils an den mutmaßlichen Bedürfnissen dieser verschiedenen Gemeinschaften orientieren sollte.
„‚Das Unbehagen in den Kulturen‘ ist eine kurze Kritik sowohl des Multikulturalismus als auch seiner Gegner.“
Neuerdings sind jedoch die Ängste vor Vielfalt gestiegen und mit diesen Ängsten auch die Feindseligkeit gegenüber dem Multikulturalismus. Betrachtete man ihn einst als Antwort auf die Probleme, die man infolge von Einwanderung erwartete, gilt er nun als Ursache eben dieser Probleme. Aber ebenso wie die Befürworter des Multikulturalismus vermischen auch seine Kritiker die beiden unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs: Aus der Kritik des Multikulturalismus wurde die Ablehnung von Einwanderung und Vielfalt, aus der Kritik einer bestimmten Sozialpolitik wurde die Kritik einer bestimmten Gesellschaftsform.
„Das Unbehagen in den Kulturen“ ist eine kurze Kritik sowohl des Multikulturalismus als auch seiner Gegner. Es entstand vor der gegenwärtigen Einwanderungskrise und den Terrorangriffen in Europa. Die hier dargelegten Thesen und Argumente bieten jedoch einen guten Rahmen zum Verständnis der aktuellen Debatten um Einwanderung und den Islam.
Was verstehen wir unter Vielfalt in einer Gesellschaft? Und warum sollten wir Vielfalt wertschätzen oder eben fürchten? Dies sind die Fragen, um die es in „Das Unbehagen in den Kulturen“ geht. Wenn wir über Vielfalt reden, meinen wir damit, dass die Welt da draußen unordentlich ist, voller Kontraste und Konflikte. Und das – so die These des Buchs – ist gut so, denn aus diesen Kontrasten und Konflikten heraus entstehen politische und kulturelle Bindungen.
Vielfalt ist wichtig, aber nicht an und für sich, sondern weil sie uns ermöglicht, unseren Horizont zu erweitern, unterschiedliche Wertvorstellungen, Glaubenssysteme und Lebensweisen gegenüber zu stellen, sie miteinander zu vergleichen und zu entscheiden, welche uns besser erscheinen als die anderen. Mit anderen Worten ist Vielfalt wichtig, weil sie uns ermöglicht, in politische Auseinandersetzungen und Debatten einzutreten, die uns paradoxerweise helfen können, eine universellere Vorstellung davon zu entwickeln, was es bedeutet, Bürger zu sein.
„Nur wenige Ereignisse lassen sowohl die Angst wie auch die Gleichgültigkeit deutlicher zutage treten als das Nachspiel der Ereignisse in der Silvesternacht 2015 in Köln.“
Meiner Beobachtung nach ist es jedoch genau jene Eigenschaft, die Vielfalt eigentlich so wertvoll macht – die kulturellen und ideologischen Auseinandersetzungen, die sie mit sich bringt –zugleich das, wovor sich viele fürchten. Diese Furcht kann zwei Formen annehmen: Einerseits kann sie in Form einer nativistischen Grundhaltung auftreten, also dem Glauben, Einwanderung gefährde den sozialen Zusammenhalt, führe zum Zerfall der eigenen nationalen Identität und verwandle unsere Städte in kleine Lahores oder mini-Kingstons. Andererseits kann diese Angst die Form einer multikulturalistischen Grundhaltung annehmen, der zufolge der Respekt vor den Anderen von uns verlangt, deren Lebensweise und Überzeugungen zu akzeptieren. Fremde Werte oder Sitten sollten nicht kritisiert oder in Frage gestellt werden. Stattdessen müssten die Grenzen zwischen den Gruppen geschützt werden, um die Auseinandersetzungen, Konflikte und Spannungen, die Vielfalt mit sich bringt, zu minimieren.
Der eine Ansatz verstärkt die Angst, der andere die Gleichgültigkeit. Der eine Ansatz betrachtet Migranten als die Anderen, deren Anderssein für die europäischen Gesellschaften eine Gefahr darstellt. Der andere Ansatz betrachtet das Anderssein der Migranten als einen Sachverhalt, den Gesellschaften respektieren und mit dem sie leben müssen.
Ein neuer Weg für mehr Vielfalt
Nur wenige Ereignisse lassen sowohl die Angst wie auch die Gleichgültigkeit deutlicher zutage treten als das Nachspiel der Ereignisse in der Silvesternacht 2015 in Köln. Eine große Zahl Frauen wurde an jenem Abend ausgeraubt und Opfer sexueller Übergriffe durch Männer, die in ihrer Mehrzahl als arabischstämmig beschrieben wurden. Zuerst versuchten die Behörden, die Ereignisse zu vertuschen und so zu tun, als sei nicht passiert. Als die Details nach und nach ans Licht kamen, folgte die unvermeidliche Empörung.
Die erste Reaktion der Behörden war nicht allein Folge der Furcht vor der öffentlichen Reaktion oder der Gefahr, dass Rassisten den Vorfall ausschlachten könnten. Sie war auch Folge einer Perspektive, wonach solche Ereignisse in einer vielfältigen Gesellschaft, in der unterschiedliche Werte, Glaubenssätze und Sitten aufeinandertreffen, unvermeidlich sind, und es besser sei, „die Araber Araber sein zu lassen“, anstatt eine ernsthafte und schwierige öffentliche Debatte über das Problem zu führen. Als dann die Wahrheit durchsickerte, richtete sich die öffentliche Wut nicht bloß gegen die für die sexuellen Übergriffe verantwortlichen Männer oder gegen die Behörden, die versucht hatten, das Geschehene zu vertuschen, sondern auch gegen Migranten im Allgemeinen. Das Ereignis wurde zum Anlass, jedwede Einwanderung nach Deutschland abzulehnen. Beide Perspektiven betrachten Migranten als die Anderen, als Menschen, die sich grundlegend von uns unterscheiden. Nur in ihren Vorstellungen, wie mit diesem Anderssein umzugehen ist, unterscheiden sich die beiden Perspektiven. Wir haben eine Welt geschaffen, in der sich Angst und Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit und Angst zu einem Gordischen Knoten verflochten haben.
„Gerade der Respekt verlangt von uns, die Werte und den Glauben anderer Menschen in Frage zu stellen.“
Keiner der beiden Ansätze versucht, sich der Frage der verbindlichen Auseinandersetzung zu nähern. Eine solche Auseinandersetzung verlangt von uns, jedwede Gruppe weder als “die Anderen“ auszusperren, deren Werte, Glauben und Sitten den unseren unausweichlich und fundamental feindselig gegenüberstehen, noch diesen Werten, Glauben und Sitten im Namen des „Respekts“ gleichgültig gegenüber zu stehen. Stattdessen gilt es zu erkennen, dass gerade der Respekt von uns verlangt, die Werte und den Glauben anderer Menschen in Frage zu stellen und uns gegebenenfalls bestimmten Auffassungen entgegen zu stellen. Respekt verlangt von uns, ernsthaft, offen und öffentlich darüber zu debattieren, welche Werte, Glaubensinhalte und Sitten wir für erstrebenswert halten. Wir müssen akzeptieren, dass diese Debatten schwierig und oftmals konflikthaft sind, müssen aber auch erkennen, dass solche Debatten notwendiger Bestandteil jeder Gesellschaft sind, die offen und liberal sein will.
Sowohl die Argumente der Multikulturalisten als auch die ihrer Kritiker sind Produkte einer Entwicklung, die man als „kulturalistische Wende“ (‚cultural turn’) bezeichnen kann: Ein Wandel, der im Laufe der vergangenen Jahrzehnte dazu geführt hat, dass heutzutage viele Menschen soziale Unterschiede vor allem als kulturbedingt verstehen.
Die Idee einer „kulturalistischen Wende“
Die Wurzeln der „kulturalistischen Wende“ reichen weit zurück, so meine These im Buch. Ihre Geschichte reicht zurück bis zur romantischen Gegenbewegung zum Universalismus der Aufklärung und zum einflussreichen Konzept der „Kultur“ des deutschen Philosophen Johann Gottfried Herder. Herder zufolge besitzt jede Kulturgemeinschaft – oder jedes „Volk“ – eine einzigartige Lebensweise, die sich in ihrem „Volksgeist“ oder ihrer „Seele“ ausdrückt.
Herder war kein Reaktionär – er war ein entschiedener Verfechter von Gleichheit und ein erbitterter Gegner sowohl der Sklaverei als auch der Kolonialherrschaft von Europäern über Nicht-Europäer. Doch seine Vorstellungen bezüglich der Verschiedenheit von Kulturen wurden von reaktionären Denkern aufgegriffen. Die Idee grundlegender Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen wurde zur zentralen These rassistischen Denkens und die Vorstellung eines „Volksgeistes“ gehörte fortan zur Ausstattung des Rassismus.
„Die alten kulturromantischen Argumente kehrten zurück, nun allerdings als ‚progressiv‘ etikettiert.“
Radikale Gegner von Rassismus und Kolonialismus verwarfen die romantische Vorstellung von Kultur und nahmen stattdessen eine universalistische Haltung ein. Von den Kämpfen gegen die Sklaverei bis hin zu den antikolonialistischen Befreiungsbewegungen ging es den Protagonisten nicht um den Schutz der eigenen besonderen Kultur, sondern um das Schaffen einer universelleren Kultur, an der jeder unter gleichen Bedingungen teilhaben konnte.
In den vergangenen Jahrzehnten hat der universalistische Standpunkt jedoch an Einfluss verloren, vor allem weil viele soziale Bewegungen, die diese Sichtweise verkörperten, zerfielen. In dem Maße, in dem breiter angelegte Kämpfe für soziale Verbesserung erlahmten, zogen sich die Menschen tendenziell immer weiter in ihre jeweiligen Glaubensvorstellungen oder Kulturen zurück und wandten sich engeren Konzepten von Identität zu. Der soziale Raum, den die großen Massenbewegungen vor ihrem Verschwinden eingenommen hatten, füllte sich mit Identitätspolitik, und die alten kulturromantischen Argumente kehrten zurück, nun allerdings als „progressiv“ etikettiert.
Als die Instrumente für politischen Wandel verfielen und die Sphäre des Politischen sich verengte, fingen die Menschen an, sich selbst und ihr soziales Umfeld auf andere Weise zu betrachten. Soziale Solidarität wird immer weniger in politischen Kategorien gedacht und immer mehr in Kategorien wie Ethnizität, Kultur, oder Religion. Die Menschen stellen sich immer weniger die Frage, „In welcher Gesellschaft will ich leben?“, sondern immer mehr „Wer sind wir?“. Beide Fragen sind natürlich eng miteinander verwoben und jedes Gefühl sozialer Identität muss beide beantworten können. Die Beziehung zwischen den beiden Fragen ist jedoch komplex und variabel.
Die Antwort auf die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben möchten, wurde in den vergangenen Jahren immer weniger von Werten und Institutionen geprägt, die Menschen durchsetzen oder aufbauen wollen, sondern von den Gruppen oder Stämmen, denen sie sich zugehörig fühlen. Zugleich wird die Antwort auf die Frage, wer wir sind, immer weniger über die Gesellschaft definiert, die man erschaffen will, und immer stärker über die Geschichte und das Erbe, dem man sich zugehörig fühlt. Oder um es anders zu sagen: In dem Maße, in dem die breiter angelegten politischen, kulturellen und nationalen Identitäten zerfielen und traditionelle soziale Netzwerke, institutionelle Autoritäten und moralische Normen an Bindungskraft verloren, wurden auch die gefühlten Zugehörigkeiten der Menschen enger und provinzieller. Heute sind diese Zugehörigkeiten weniger durch die Möglichkeiten einer zu gestaltenden Zukunft geprägt als durch die (oft mythisch verklärte) Vergangenheit.
„‚Differenz‘ betont und übertrieben.“
Anders ausgedrückt: Die weltanschauliche gebundene Politik wurde ersetzt durch eine Politik, die identitär gebunden ist. Dieser Entwicklung hat sowohl das Verhältnis der Minderheiten zur Mehrheitsgesellschaft geprägt als auch die Art, wie Migranten von vielen betrachtet werden. Zunächst definieren sich die Minderheiten nun ebenso wie die Mehrheiten anhand engerer Kriterien, die sich vor allem um Kultur, ethnische Zugehörigkeit oder Religion drehen. Folglich wird „Differenz“ betont und übertrieben. Viele Mitglieder von Minderheiten versuchen, sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft durch ein Gefühl der Differenz zu finden, des Andersseins von anderen Minderheiten. Auch viele Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft sehen in den Angehörigen von Minderheitengruppen vor allem die „Anderen“. Zugleich begannen viele, Einwanderung als Quelle der Auflösung oder des Zerfalls der nationalen Kultur zu betrachten und folglich als eine Bedrohung, der es zu widerstehen gilt.
Politische Probleme als solche betrachten
All dies ist Folge des Abwendens weg von politischen Konzeptionen sozialer Beziehungen hin zu in erster Linie kulturellen Sichtweisen. Politische Kämpfe zerteilen Gesellschaften entlang weltanschaulicher Grenzen, doch sie verbinden über ethnische oder kulturelle Grenzen hinweg; kulturelle Kämpfe führen unausweichlich zur Fragmentierung. In politischen Konflikten kommt es nicht darauf an, wer du bist, sondern darauf, woran du glaubst. Für kulturelle und ethnische Konflikte gilt das Gegenteil. Politische Kämpfe sind oft sinnvoll, weil sie soziale Probleme auf eine Weise betrachten, die fragt: „Wie können wir die Gesellschaft so ändern, dass dieses Problem gelöst wird?“ Betrachten wir etwa Rassismus aus politischer Perspektive, müssen wir fragen: „Was sind seine sozialen Wurzeln und welche strukturellen Änderungen sind nötig, um ihn zu bekämpfen?“ Möglicherweise gibt es unterschiedliche Meinungen, welche Antwort die richtige ist, aber die Debatte selbst ist bereits nützlich. Anders ausgedrückt: Politische Konflikte sind jene Konflikte, die geführt werden müssen, um sozialen Wandel zu ermöglichen.
„Versuche, Vielfalt mit Hilfe multikulturalistischer Politik zu ordnen, haben wesentlich zu Problemen beigetragen.“
Die „kulturalistische Wende“ hat die Menschen dazu verleitet, politische Probleme als kulturelle, ethnische oder religiöse Konflikte zu begreifen und politischen Fragen eine Form gegeben, in der sie weder hilfreich noch lösbar sind. Anstatt nach den gesellschaftlichen Wurzeln von Rassismus zu fragen und danach, welche strukturellen Änderungen geeignet sind, ihn zu bekämpfen, verlangt ein multikulturalistischer Zugang die Anerkennung der jeweiligen Identitäten. Es geht in erster Linie um die öffentliche Bestätigung des kulturellen Anders-Seins und Respekt und Toleranz für die die jeweiligen kulturellen und religiösen Glaubenssätze.
Weiter oben schrieb ich, Auseinandersetzungen und Konflikte seien etwas Positives. Ich meinte damit nicht, jede Auseinandersetzung und jeder Konflikt seien gut. Es kommt stark darauf an, wie sich ein Konflikt ausdrückt: Auseinandersetzungen über Ideen und Werte sind oft wertvoll und die Voraussetzung für sozialen Wandel. Der multikulturalistische Versuch, solche Konflikte im Namen von „Toleranz“ und „Respekt“ zu minimieren, löst nicht die Konflikte, sondern verwandelt politische und weltanschauliche Konflikte in Gemeinschafts- und Kulturkonflikte. Auf diese Weise wird erstens jener Streit der Meinungen ausgebremst, der politische Früchte tragen kann. Zweitens werden jene Konflikte losgetreten, die sozial schädlich sind. Aus politischen Debatten werden kulturelle Zusammenstöße. Weil die einzelnen Individuen in ihren Kulturen und Identitäten eingeschlossen werden, werden solche Zusammenstöße sowohl unausweichlich als auch unlösbar.
Müsste ich mich auf eine einzige Botschaft festlegen, die die Leser von der Lektüre meines Buches mitnehmen sollen, dann ist es die, dass Vielfalt genau deshalb positiv ist, weil sie unübersichtlich ist. Versuche von Regierungen, Vielfalt mit Hilfe multikulturalistischer Politik zu ordnen, haben wesentlich dazu beigetragen, jene Probleme zu schaffen, die eigentlich durch diese Politik gelöst werden sollten.